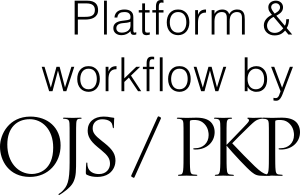Präferenzen von Bestandskunden für direkt gehandelten Spezialitätenkaffee am Beispiel der Marke elbgold
Liebe Leserinnen und Leser,
Der Begriff Spezialitätenkaffee wurde erstmals 1974 verwendet und von Erna Knutsen eingeführt. Sie wird auch als „Godmother of Coffee“ bezeichnet. Spezialitätenkaffee ist ein Kaffee mit charakteristischen Eigenschaften und einer besonderen Qualität. Sein Anteil auf dem deutschen Kaffeemarkt steigt. Gründe liegen hier in der steigenden Nachfrage nach zertifiziertem Kaffee (z.B. Bio oder Fairtrade), der steigenden Bedeutung von Nachhaltigkeit in der Gesellschaft, dem Bewusstsein für soziale Verantwortung und dem steigenden Segment des Online- und Direkt-Handels.
Lesen Sie in folgendem Beitrag,
welche Faktoren den Konsum und das Kaufverhalten bei Bestandskunden eines Spezialitätenkaffees bestimmen. In Kooperation mit der elbgold Röstkaffee GmbH wurde eine Befragung bei den Bestandskunden durchgeführt. Sie zeigt welches die intrinsischen und extrinsischen Merkmale von Spezialitätenkaffee sind, die in erster Linie dazu führen, dass Konsumenten sich für einen teuren Kaffee hoher Qualität entscheiden.
Schauen Sie auch nach weiterführenden Informationen und innovativen Projekten zu landwirtschaftlichen Themen im Forschungsinformationssystem Agrar und Ernährung (FISA), www.fisaonline.de.
- Optimierung der Kundenbindung bei Direktvermarktern
- Zielkonflikt beim Lebensmitteleinkauf: Konventionell regional, ökologisch regional oder ökologisch aus entfernten Regionen
- Fairtrade 2.0 - Coffee Made in Africa
- Qualitätssicherung bei Arabica-Kaffees aus progressiver Rohkaffeeproduktion: Verbesserung der Kaffeearomaqualität durch gezielte Modifikation der Aufbereitung
Ihre Redaktionen BüL-Berichte über Landwirtschaft & FISA-Forschungsinformationssystem Agrar und Ernährung
Lesen Sie mehr über Präferenzen von Bestandskunden für direkt gehandelten Spezialitätenkaffee am Beispiel der Marke elbgold